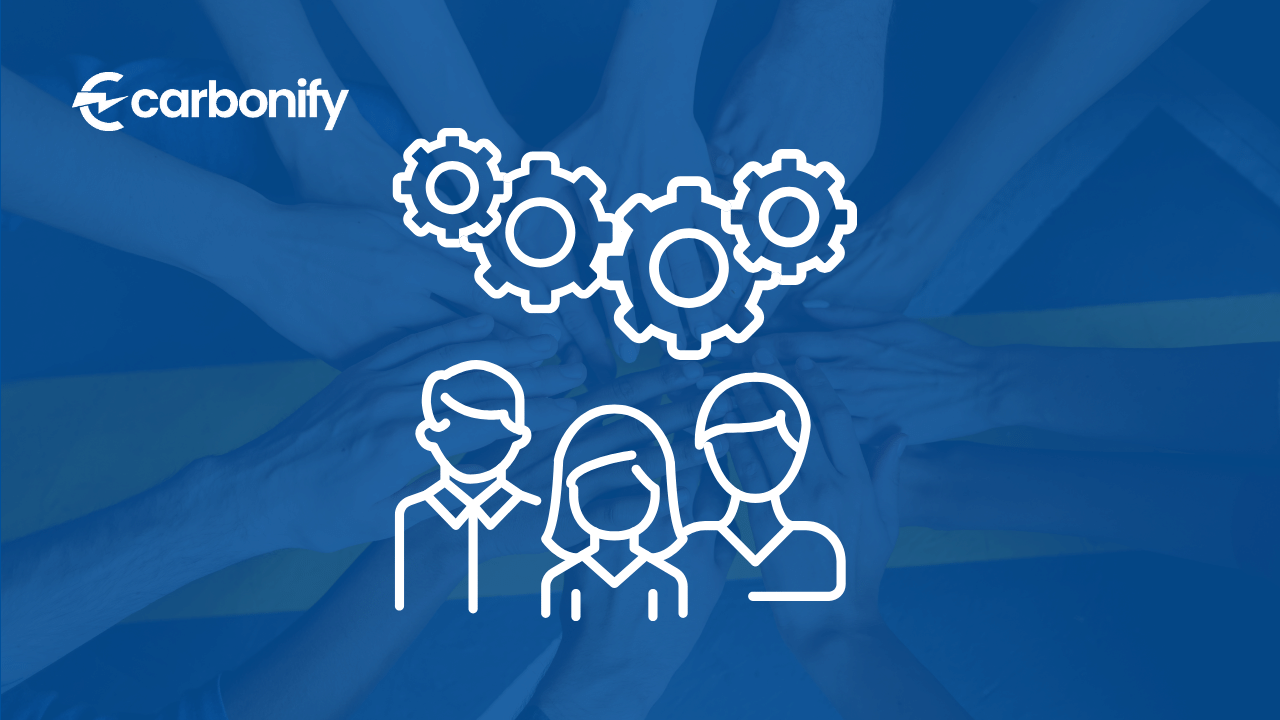Induktives Laden: Auto mit Elektroantrieb kabellos laden
25.11.2025 · Elektromobilität
Von Alischa Knüttel

Induktives Laden eines Autos mit Elektroantrieb wird die Zukunft der E-Mobilität nachhaltig verändern. Wenn du bereits in einem E-Auto unterwegs bist, weißt du nur zu gut, wie aufwendig das derzeitige Laden manchmal sein kann. Ein E-Auto induktiv zu laden bedeutet, anstatt umständlich eine Ladestation aufzusuchen, Kabel auszurollen und anzuschließen, werden E-Fahrzeuge künftig automatisch und kabellos geladen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Die gute Nachricht: Der Traum ist zum Greifen nah!
In diesem Beitrag beleuchten wir einmal näher induktives Laden eines Elektroautos und zeigen dir, was es damit auf sich hat und wo wir aktuell bei der Entwicklung stehen.
Wissenschaftler in Braunschweig haben bereits eine innovative Ladeplatte für induktives Laden eines E-Autos entwickelt. Erste Praxistests laufen ebenso in Berlin, wo Busse an Haltestellen während kurzer Stopps kabellos aufgeladen werden.
Was bedeutet es, ein E-Auto induktiv zu laden?
Ein Blick in die Geschichte der Elektromobilität zeigt: Bereits 1831 entdeckte der britische Physiker Michael Faraday, dass eine stromführende Leitung ein Magnetfeld erzeugt, das wiederum Strom induzieren kann. Wenn zwei Leitungen optimal ausgerichtet sind, lässt sich Energie kabellos durch die Luft übertragen. Genau das wird heute als induktives Laden bezeichnet. Dank Faraday können wir heute die Vorteile eines Induktionsherds nutzen.
Nun aber zurück zum induktiven Laden eines E-Autos. Dies bedeutet zunächst einmal, dass der Ladevorgang gänzlich ohne Kabel abläuft. Die Übertragung der Energie erfolgt über ein Magnetfeld, das zwischen zwei Spulen, von denen eine im Boden und die andere im Fahrzeug verbaut ist, entsteht. Je präziser die Spulen übereinander positioniert sind, desto effizienter funktioniert der Energieaustausch.
Denkbar ist etwa ein System, bei dem das Auto einfach geparkt wird und die Energieübertragung induktiv erfolgt – ohne Ladesäulen. Alternativ könnten spezielle Fahrspuren genutzt werden, mit denen induktives Laden während der Fahrt auf der Autobahn stattfindet.
Noch steht die Technologie am Anfang: Die übertragene Leistung ist derzeit begrenzt. Induktives Laden eines E-Autos erreicht einen Wirkungsgrad von 93 bis 95 Prozent. Eine konsequente Weiterentwicklung ist notwendig, um eine flächendeckende Nutzbarkeit sicherzustellen.
Wie funktioniert induktives Laden beim Elektroauto?
Schauen wir noch einmal genauer auf die Funktionsweise des induktiven Ladens eines E-Autos. Ein gutes Beispiel, um dies zu verdeutlichen, ist ein Versuch des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, das Aufladen während der Fahrt erfolgreich zu demonstrieren. Auf einer Teststrecke von 25 Metern haben sie gezeigt, wie Strom kabellos direkt in ein Fahrzeug übertragen wird.
Dafür wurden spezielle Spulen in den Asphalt integriert. Sobald das E-Auto mit der speziellen Vorrichtung darüber fährt, entsteht für wenige Millisekunden ein Magnetfeld. Dieses ermöglicht es einer weiteren Spule, die an der Unterseite des Fahrzeugs angebracht ist, den Strom kontaktlos aufzunehmen. Der große Vorteil: Das Aufladen erfolgt vollkommen nahtlos während der Fahrt, sodass Unterbrechungen für Ladestopps der Vergangenheit angehören könnten.
Eine Alternative zum induktiven Laden eines E-Autos während der Fahrt ist es, dieses während des Parkvorgangs kabellos aufzuladen. Das Prinzip bleibt das gleiche. An der Unterseite des Autos befindet sich eine Empfangsspule. Sobald das Auto genau über dieser Ladeplatte geparkt wird, wird Energie durch ein Magnetfeld von der Platte zur Spule übertragen. Das würde auch in der heimischen Garage umsetzbar sein.
MobiLab
Eine weitere Teststrecke für induktives Laden eines E-Autos ist Teil des Reallabors MobiLab, das einen autofreien Campus an der Universität Stuttgart zum Ziel hat. Neben dem kabellosen Laden während der Fahrt entwickelt ein Team autonom fahrende E-Scooter und ein CampusShuttle.
Die Strecke auf dem Campus Vaihingen umfasst 40 Spulenelemente mit jeweils 50 × 48 Zentimetern Grundfläche. Der Abstand zwischen Fahrzeug und Spulen beträgt 20 Zentimeter. Die Position des Fahrzeugs wird automatisch erkannt. Dabei werden nur die notwendigen Primärspulen im Boden aktiviert. Durch magnetische Kopplung erfolgt die Übertragung der Energie proportional zur Spulenfläche. Bei einer Fläche von 0,24 Quadratmetern ist eine konstante Leistung beim induktiven Laden des E-Autos von 10 kW sichergestellt – deutlich mehr als die 2,3 kW einer herkömmlichen Steckdose. So ermöglicht die Strecke ein durchgehendes, effizientes Laden während der Fahrt.
Welche Vorteile hat es, ein Elektroauto kabellos zu laden?
Das induktive Laden von Elektroautos bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die deinen Alltag als E-Mobilist deutlich erleichtern und effizienter gestalten. Ohne Ladekabel entfällt nicht nur der Platzbedarf im Kofferraum, sondern auch die Gefahr von Fehlbedienungen. Zudem könnte sich damit in Zukunft die Akkugröße reduziert lassen, wenn eine induktive, öffentliche Ladeinfrastruktur ausreichend verfügbar ist. Dies spart Zeit und macht das Laden noch praktischer.
Alle Vorteile des induktiven Ladens eines E-Autos im Überblick:
- Kein An- und Abstecken von Kabeln, das Laden beginnt automatisch bei korrekter Positionierung.
- Geeignet für regelmäßige Parkvorgänge, etwa in Garagen oder auf festen Stellplätzen.
- Da keine Kabelverbindungen genutzt werden, halten die Ladeeinrichtungen länger.
- Kein Ärger mit nassen oder vereisten Kabeln; Ladeplatten sind sicher für Menschen und Tiere.
- Ordentliche, moderne Optik ohne sichtbare Kabel in Garagen oder öffentlichen Bereichen.
- Besonders geeignet für schwer zugängliche Anschlüsse oder Fahrzeuge mit speziellen Designs.
Gut zu wissen: Induktive Ladestrecken bringen vor allem für autonome Fahrzeuge entscheidende Vorteile mit. Da der Ladevorgang ohne Standzeiten erfolgt, könnten diese Fahrzeuge nahezu ununterbrochen im Einsatz bleiben.
Autos in Deutschland kabellos aufladen – der Status quo
Deutschland und Schweden zählen zu den Vorreitern bei der Entwicklung und dem Ausbau einer Ladeinfrastruktur mit induktivem Laden und führen weltweit die meisten Praxisstudien durch. Angesichts des wachsenden Strombedarfs von Elektrofahrzeugen setzen beide Länder auf unterschiedliche Ansätze. In Deutschland werden etwa Autobahnabschnitte testweise mit Oberleitungen ausgestattet, um schwere Lkw mit Energie zu versorgen.
Induktives Laden und das eCharge-Projekt
Im Projekt „eCharge“ der TU Braunschweig untersuchen Wissenschaftler das induktive Laden während der Fahrt. Dafür werden sogenannte „Coils“ in den Asphalt integriert. Ziel ist die Einrichtung 25 Kilometer langer „E-Korridore“ auf Autobahnen, die die E-Auto-Reichweite erhöhen sollen. Und das um bis zu 20 Prozent. Die Technologie stammt vom israelischen Unternehmen ElectReon und wird auch in Folgeprojekten genutzt.
Induktive Straßen auf der Insel Gotland
Ein innovatives Beispiel für induktive Straßen ist die Insel Gotland in Schweden, wo Kupferspulen unter dem Asphalt Fahrzeuge kabellos laden. Die Spulen werden durch eine 240-kW-Batterie von Vattenfall betrieben, die mit Solarenergie versorgt wird. Ähnliche Systeme werden in Deutschland getestet, etwa in Karlsruhe, wo eine Buslinie über Induktionsladung mit Strom versorgt wird.
DWPT-Technologie und Arena del Futuro
Ein großer Fortschritt beim induktiven Laden eines E-Autos ist „Dynamic Wireless Power Transfer“-System (DWPT). Leiterschleifen unter dem Asphalt übertragen Energie direkt an Fahrzeuge, die mit einem speziellen Empfänger ausgestattet sind. Tests auf der „Arena del Futuro“ haben gezeigt, dass Fahrzeuge bei Autobahngeschwindigkeit fahren können, ohne die eigene Batterieleistung zu nutzen. Der Energiefluss ist dabei so effizient wie bei Schnellladestationen. Messungen bestätigen zudem, dass die Magnetfelder weder Menschen noch der Umwelt schaden. Dank der geschlossenen Bauweise sind die Straßen sicher und frei von freiliegenden Kabeln. Über die Kosten gibt es allerdings noch keine Angaben.
Projekt ELINA und weitere Pilotstrecken
In Balingen testet die EnBW seit 2023 die DWPT-Technologie im Projekt ELINA. Gemeinsam mit Electreon, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und den Stadtwerken Balingen wurde auf einer 400-Meter-Teststrecke Magnetspulen im Asphalt verlegt. Zusätzlich wurden Ladepunkte an einer Messehalle und Endhaltestelle eingerichtet. In einer zweiten Phase erweiterte man das Projekt Ende 2023 auf reguläre Buslinien.
Auch in Nordbayern entsteht eine Teststrecke für induktives Laden. Bis 2025 soll ein Autobahnabschnitt mit einer Länge von einem Kilometer entstehen, der Fahrzeuge während der Fahrt mit rund 70 kW Leistung versorgt. Neben der Erprobung der Technik zielt das Projekt auf die Entwicklung von Standards und optimierten Bauprozessen für solche Straßen ab.
Bidirektionales Laden und autonomes Fahren
Am Institut für Automation und Kommunikation in Magdeburg untersuchten Forscher im Rahmen des Projekts FEEDBACCAR das bidirektionale Laden autonomer Elektroautos. Dabei konnte gezeigt werden, dass sowohl kabelloses Laden als auch die Rückspeisung von Strom ins Netz technisch machbar sind. Tests erreichten eine Leistung von bis zu 11 kW mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, Fahrzeuge als flexible Energiespeicher einzusetzen.
Wann wird induktives Laden beim E-Auto massentauglich?
Bis Elektroautos flächendeckend auf Supermarktparkplätzen, an Ampeln oder sogar während der Fahrt auf der Autobahn induktiv geladen werden können, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Die Entwicklung der Technologie wird voraussichtlich zuerst bei Fahrzeugen wie Taxen, Elektrobussen oder Lkw vorangetrieben, die während längerer Einsätze auf flexible und unterbrechungsfreie Energieversorgung angewiesen sind. Fachleute gehen davon aus, dass induktives Laden eines E-Autos dann zunächst in der Oberklasse der Elektrofahrzeuge Einzug hält.
Bis dahin bleibt die bestehende Ladeinfrastruktur von zentraler Bedeutung, um die Elektromobilität weiter auszubauen.
Wie Unternehmen Elektroautos bald kabellos laden und doppelt profitieren
Zum 1. Oktober 2025 waren deutschlandweit 179.938 öffentliche Ladepunkte bei der Bundesnetzagentur registriert. Dabei handelte es sich um 135.691 Normalladepunkte und 44.247 Schnellladepunkte, wobei auch Säulen erfasst werden, deren Anzeigeverfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Der Fokus aktueller Förderprogramme liegt generell verstärkt auf dem Ausbau gewerblicher und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. Unternehmen, die Ladepunkte an ihren Standorten bzw. für ihre Flotten errichten und diese öffentlich zugänglich machen, profitieren dabei doppelt: Zum einen durch staatliche Fördermittel, zum anderen durch attraktive Einnahmen über die THG-Quote. Für jeden abgegebenen Ladestrom gibt es bares Geld pro Kilowattstunde – vorausgesetzt, die Ladepunkte sind bei der Bundesnetzagentur registriert.
Jetzt THG-Prämie für betriebliche Ladeinfrastruktur erhalten
Die administrativen Prozesse zur Anmeldung und Vermarktung der THG-Quote übernehmen wir von carbonify schnell, zuverlässig und transparent für dein Unternehmen. Dadurch bleibt das Kerngeschäft Fokus, während wir sicherstellen, dass Betriebe das volle wirtschaftliche Potenzial ihrer E-Flotte und ihrer Ladeinfrastruktur ausschöpfen.
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die betriebliche Ladeinfrastruktur jetzt und in Zukunft einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und zum Erfolg von Unternehmen leistet. Mit carbonify befinden sich sowohl private als auch gewerbliche E-Auto-Nutzer auf direktem Weg in eine nachhaltigere, wirtschaftliche Zukunft, die mit dem induktiven Laden von E-Autos noch attraktiver wird.
👉 Jetzt THG-Quoten aus öffentlicher Ladeinfrastruktur und E‑Fahrzeugen vermarkten
Das sagen unsere Geschäftspartner und Kunden über uns.
Was Dich noch interessieren könnte:
Wir haben alle weiteren Informationen für Dich in unseren FAQ zusammengetragen.
Wähle eine Kategorie
Was versteht man unter dem THG-Quotenhandel?
Der THG-Quotenhandel liegt der THG-Quote zugrunde. Unternehmen, wie Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe, (z. B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu reduzieren.
Im Jahr 2030 soll dieser Satz bei 25 % liegen. Bei Nichteinhaltung der Quote wird eine Strafzahlung (Pönale) für jede nicht eingesparte Tonne CO2 fällig. Die Pönale ist wesentlich teurer: Aktuell liegt sie bei 600 € pro Tonne ausgestoßenem CO2.
Die THG-Quoten von Dritten wie z. B. E-Mobilisten aufzukaufen, wenn quotenverpflichtete Unternehmen ihre THG-Quote nicht durch andere Maßnahmen, wie z. B. das Beimischen von Ökokraftstoffen erfüllen können, bildet die Nachfrage im THG-Quotenhandel.
Auf welcher Gesetzesgrundlage werden die Zertifikate der THG-Quote ausgegeben?
Die THG-Quote ist durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV Nr. 38) geregelt. Gemäß der 38. Bundes-Emissionsschutzverordnung ist das Umweltbundesamt für die Prüfung der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zuständig und zertifiziert die von carbonify eingereichten THG-Quotenanträge.
An wen wird die THG-Quote verkauft?
Hauptsächlich sind es Mineralölkonzerne, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen der THG-Quote jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz zu mindern.
Halten die quotenverpflichteten Unternehmen sich nicht an Ihre Quote, wird eine Strafzahlung für jede nicht eingesparte Tonne CO2 in Höhe von 600 € pro Tonne CO2 fällig.
Ein Quotenverpflichteter hat unterschiedliche Erfüllungsoptionen, um die Anforderungen der THG-Quotenerfüllung zu bewerkstelligen. Insbesondere ist es der Verkauf von Biokraftstoffen, wie z. B. E10 oder E5 an der Tankstelle.
Da die THG-Minderungsquote in den vergangenen Jahren jedoch bedeutend gestiegen ist und bis 2030 auf 25 % steigen wird, schaffen Mineralölkonzerne es nicht allein durch den Verkauf von Biokraftstoffen die Anforderungen zu erfüllen, sodass Strafzahlungen drohen. Deswegen werden THG-Quotenmengen durch öffentliche Ladeinfrastruktur generiert oder die eingesparten CO2-Emissionen von Privatpersonen oder Unternehmen gekauft.
Wer kann die THG-Quote beantragen?
Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.
Für welchen Zeitraum kann die THG-Quote von E-Mobilisten und Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden?
Die THG-Quote kann einmal pro Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragt werden. Gesetzlich ist das Instrument bis 2030 vorgesehen.
Weitere Fragen?
Schreib uns!
Mit unserem kompetenten Team kommst Du immer ans Ziel! Schreib uns gerne Dein Anliegen und Du kriegst werktags innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.